
Das 22. Ost- und Westeuropäische Gedenkstättenseminar, das vom 19. bis 22. März 2025 Experten, Forscher und Vertreter von Gedenkstätten aus ganz Europa in Kreisau zusammenbrachte, ist zu Ende gegangen. Im Mittelpunkt der diesjährigen Ausgabe standen die Rolle von Bildern und Fotografien bei der Gestaltung des historischen Gedächtnisses sowie die Herausforderungen, die das moderne digitale Zeitalter und die Entwicklung der künstlichen Intelligenz mit sich bringen.
Wichtige Überlegungen und Diskussionen
Images of Violence, das Eröffnungspanel, das sich mit der Interpretation von Fotografien befasste, die Kriegsverbrechen dokumentieren. Wie eine Person bemerkte: „Es gibt viele Fotos, die auf den ersten Blick kein Leid zeigen, aber die Frage, wie sie zu interpretieren sind, muss beantwortet werden“.
Bilder der Lager - eine Diskussion über die visuelle Dokumentation von Hinrichtungsstätten und ihre Auswirkungen auf das kollektive Gedächtnis.
Bilder der Besatzung - ein Gespräch über die fotografische Aufzeichnung der Besatzungserfahrung und ihre Verwendung bei der Konstruktion historischer Erzählungen. Experten wiesen auf die Gefahren der Manipulation von Bildern hin und stellten fest, dass „Propaganda nur dann Macht hat, wenn wir die Geschichte nicht kennen.“
Sowjetische Denkmäler - das Thema des Vorhandenseins und der Entfernung sowjetischer Denkmäler im öffentlichen Raum und ihre Rolle im historischen Gedächtnis nach 1990.
Studienreise nach Breslau - die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, die Veränderungen in der Wahrnehmung von Denkmälern vor und nach 1989 zu analysieren.
Versöhnung und visuelles Gedächtnis - ein abschließendes Panel, das die Bedeutung von Versöhnungsgesten und ihren Bildern in der öffentlichen Debatte diskutierte.
Weiterlesen: 22. Seminar der Gedenkstätten in Kreisau - Zusammenfassung
.png)
„Bilder, Macht und Deutungskämpfe in Europa zwischen 1945, 1990 und 2025“
In wenigen Tagen findet in Krzyżowa/Kreisau das 22. Ost-West-Europäische Gedenkstättentreffen statt, das sich mit dem historischen Bildgedächtnis im Kontext zweier historischer Zäsuren beschäftigt: „80 Jahre Kriegsende“ und „35 Jahre Jahre Zusammenbruch der kommunistischen Staaten“.
Die Konferenz wird sich mit der Rolle von Fotografie und Bildern in der historischen Erinnerung an die Ereignisse des 20. Jahrhunderts in Ost- und Westeuropa befassen. Wie wurden Fotografien vor und nach 1990 in Gedenkstätten, in Museen, Dokumentationszentren und Ausstellungen eingesetzt? Welche Veränderungen gab es in der Verwendung von Bildern und historischen Narrativen nach den Umbrüchen der Jahre 1989–1990? Und welche Herausforderungen bringt das digitale Zeitalter mit sich – insbesondere mit Blick auf die Entwicklung der künstlichen Intelligenz?
Ziel der Tagung ist es, zu verstehen, wie Bilder, Filme und Fotografien, die während des Kalten Krieges auf beiden Seiten des Eisernen Vorhanges als Beweismaterial in juristischen Prozessen eingesetzt wurden, die kollektive Erinnerung in Europa beeinflussten. Wie wurden sie nach 1990 zu Elementen konkurrierender historischer Erzählungen? Im Kontext der nationalsozialistischen Verbrechen, deren Bilder in Westeuropa ein fester Bestandteil des kollektiven Gedächtnisses sind, sowie der stalinistischen Verbrechen, die lange Zeit ignoriert und oft ohne visuelle Beweise blieben, wird die Konferenz auch die Unterschiede in der Erinnerung an diese beiden totalitären Regime thematisieren.
Angesichts fortschreitender Digitalisierung, der Abnahme von Zeitzeugenberichten und der Gefahr der visuellen Manipulation stellt die Tagung die Frage nach der aktuellen Rolle von Bildern in der Gestaltung zeitgenössischer Narrative über Kriegsverbrechen und Besatzungsregime. Wie verändert sich der Einsatz visueller Materialien im Zeitalter sozialer Medien und digitaler Propaganda?
„Bilder, Macht und Deutungskämpfe…“ lädt zu einem internationalen Dialog ein, um zu diskutieren, wie verschiedene Gesellschaften mit der Erinnerung an die einschneidenden Ereignisse des 20. Jahrhunderts umgehen. Die Konferenz bietet Museen, Gedenkstätten, Forschenden und Expert*innen eine Plattform für den Austausch von Erfahrungen und Ideen und fördert eine kritische Reflexion über die Erinnerungskultur in modernen Demokratien.
Die Veranstaltung wird durch das polnische Ministerium für Kultur und Nationales Erbe im Rahmen des in Krzyżowa/Kreisau umgesetzten Projektes „Umfassende Betreuung des Programms zur Erinnerung an den 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs und zur Würdigung der Maßnahmen zur Überwindung der Kriegsfolgen in Europa“ gefördert.
 (2).jpg)
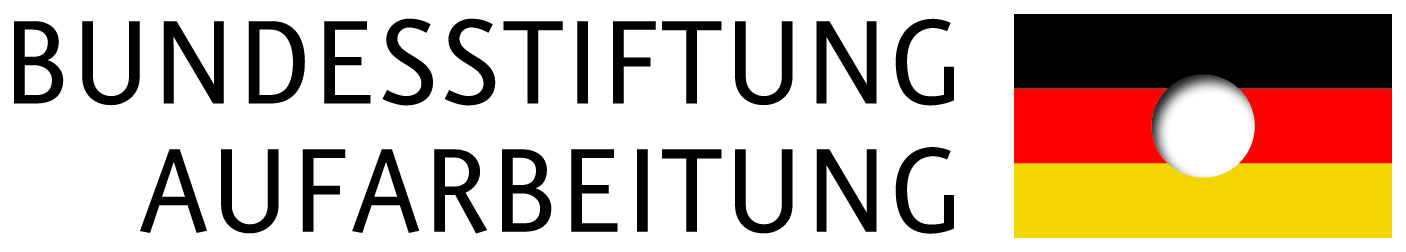



Das Gedenkstättentreffen in Kreisau richtet sich an Museen und Gedenkstätten in Europa und der Welt. Es dient dem Austausch von Expert*innen und Multiplikator*innen zum Thema. Sie befördert die Vernetzung der Institutionen und Einrichtungen untereinander und hat das Ziel die Zusammenarbeit zu stärken.
Die Tagung fragt gezielt nach den Debatten, die mit der Einrichtung von Denkmalen einhergehen. Wie werden Diktaturerfahrungen in Denkmälern ausgedrückt und inwiefern werden Nationalsozialismus und Kommunismus dabei voneinander differenziert oder gemeinsam gedacht und erinnert? Was änderte sich nach den Zäsuren 1945 oder 1989? Welchen Veränderungen unterliegen Gedenkzeichen, die den Opfern von Gewalt gewidmet sind? Welche Rolle spielt das Thema Opferkonkurrenz? Welche Rolle spielt das Thema Aufarbeitung von Verbrechenskomplexen und Transitional Justice bei der Einrichtung von Gedenkorten? Welche Trends sind bei den Gedenkzeichen zu erkennen, die sich vermeintlichen oder tatsächlichen Helden widmen? Welche Rolle spielt das Thema Geschlechtergeschichte bei Gedenkzeichen damals und heute? Und welchem Wandel unterliegt die Formensprache von Gedenkzeichen? Schließlich fragt die Tagung danach, was Gedenkzeichen und Erinnerungsorte für die Herausbildung einer demokratischen Erinnerungskultur leisten können?
Weiterlesen: 21. Gedenkstättentreffen in Kreisau/Krzyżowa, Spaces of Memory 3. – 6. April 2024




.png)
 (2).jpg)




