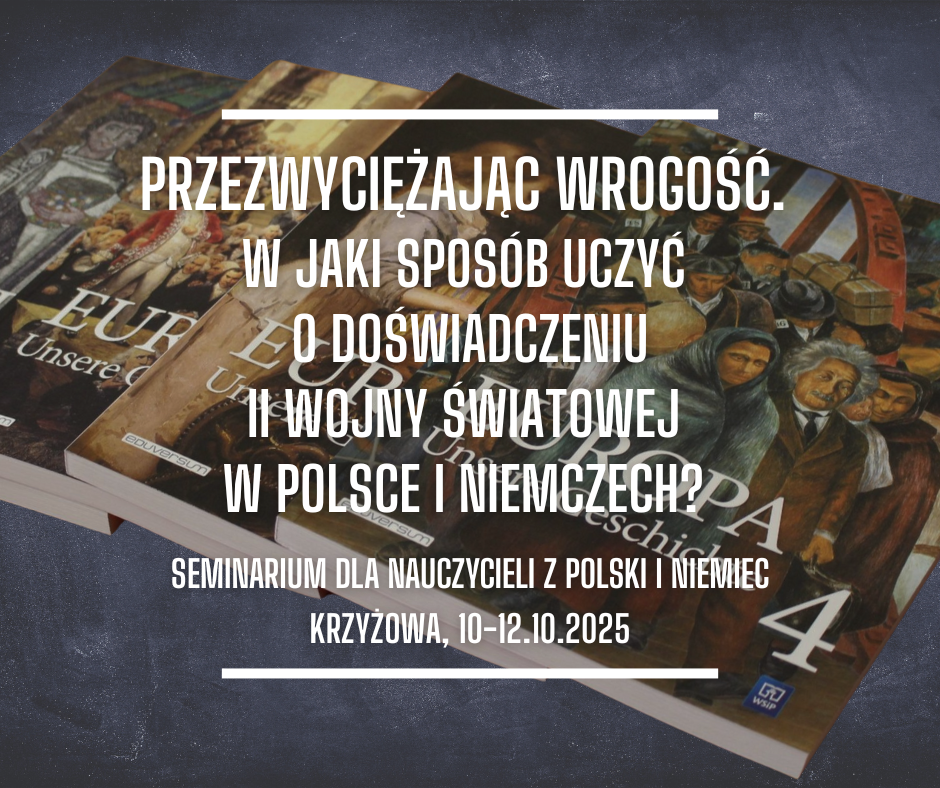
Vom 10. bis 12. Oktober fand in Kreisau ein Seminar für Lehrkräfte und Bildungsfachleute aus Polen und Deutschland unter dem Titel „Feindschaft überwinden. Wie kann man über die Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs in Polen und Deutschland lehren?“ statt.
Ziel des Seminars war es:
- das Wissen über die Geschichte der polnisch-deutschen Beziehungen (von 1939 bis heute) zu vertiefen,
- die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der polnischen und deutschen Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg, den Holocaust und die Nachkriegszeit zu beleuchten,
- die Erfahrungen von Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern und Lehrkräften vorzustellen, die in der Gemeinsamen Deutsch-Polnischen Schulbuchkommission tätig sind,
- die Möglichkeiten der Nutzung des gemeinsamen deutsch-polnischen Geschichtsbuchs „Europa. Nasza historia / Europe – Unsere Geschichte“ aufzuzeigen,
- die Potenziale des Einsatzes großer Sprachmodelle (LLM) in der Bildungsarbeit zu präsentieren,
- sowie die Teilnehmenden miteinander zu vernetzen und ihnen die Kooperationsmöglichkeiten mit polnischen Organisationen vorzustellen, die im Bereich der historischen und politischen Bildung tätig sind.
Am Seminar nahmen 60 Personen aus Polen und Deutschland teil.
Weiterlesen: Feindschaft überwinden...Seminar für Lehrerinnen und Lehrer 10.–12. Oktober 2025, Kreisau

Stiftung Kreisau Mitveranstalter des polnisch-deutsch-ukrainischen Kongresses | 22.–24. September, Warschau
Vom 22. bis 24. September findet in Warschau der III. Kongress der Forschenden zur Geschichte von Belarus, Litauen, Polen und der Ukraine statt. Das diesjährige Motto lautet:
„A New Image of Our Neighbours – A New Language, New Narratives, and New Education about the Past, Present, and Future“.
Ein zentrales Thema des Kongresses ist der Beginn der Arbeiten an einem zukünftigen polnisch-ukrainischen Geschichtsbuch für Schulen, das auf den Erfahrungen mit dem polnisch-deutschen Geschichtsbuchprojekt aufbaut.
Die Organisatoren betonen in ihrer Einladung:
„Mit der russischen Invasion in die Ukraine 2014 und dem großangelegten Krieg 2022 wurde deutlich, dass die historische Bildung in Europa – insbesondere zu den Ländern Mittel- und Osteuropas – erhebliche Defizite aufweist.
Deshalb ist es heute wichtiger denn je, einen offenen Dialog über Geschichte zu führen, um Wissenslücken zu schließen – damit Geschichte verbindet und nicht trennt.“
Das neue polnisch-ukrainische Geschichtsbuch soll auf die Erfahrungen des Projekts Europa. Nasza historia / Europa – Unsere Geschichte zurückgreifen, das zu einer vierbändigen Lehrbuchreihe geführt hat.
Weiterlesen: Auf dem Weg zum polnisch-ukrainischen Geschichtsbuch

Vom 19. bis 21. September fand in Kreisau ein Fortbildungsseminar für Pädagoginnen und Pädagogen statt.
Thema war die Geschichte der Verschleppung polnischer Kinder durch die deutschen Besatzungsbehörden während des Zweiten Weltkriegs, das Schicksal der geraubten Kinder nach Kriegsende sowie das bis heute andauernde Verbrechen der Entführung ukrainischer Kinder durch die russischen Behörden.
Im Rahmen des Seminars wurden folgende Themen behandelt:
.png) Україномовна версія нижче
Україномовна версія нижче
Wir laden alle Menschen mit fließenden Ukrainisch-Sprachkenntnissen ein, sich diesen einzigartigen Film zum Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs anzusehen. Der Film präsentiert zwei zutiefst bewegende Geschichten – die Schicksale von Barbara und Hanna –, die eine weniger bekannte, aber äußerst schmerzhafte Seite des Krieges offenbaren.
Barbara ist ein polnisches Mädchen, das im Alter von vier Jahren von den Nazis ihrer Mutter weggenommen, germanisiert und anschließend allein nach Polen zurückgeschickt wurde – wobei ihre Identität zuvor vollständig ausgelöscht worden war. Hanna ist eine Ukrainerin, die zwangsweise zur Arbeit ins Dritte Reich deportiert wurde. Nach ihrer Rückkehr war sie mit Undankbarkeit, Stigmatisierung und Schweigen konfrontiert. In den über 100 Jahren ihres Lebens trug sie einen Schmerz in sich, über den sie nicht zu sprechen wagte.
In diesem Dokumentarfilm tritt zudem Dr. Tomasz Skonieczny, der stellvertretende Direktor der Europäischen Akademie unserer Stiftung, als Interviewpartner auf. Obwohl sein einstündiges Gespräch über das Schicksal entführter Kinder für den Film auf eine Minute gekürzt wurde, sind wir stolz, an diesem wichtigen Akt des Nachdenkens teilhaben zu können – gerade heute, da hinter der Ostgrenze unseres Landes erneut ein Krieg tobt, der Menschen ihrer Kindheit und Identität beraubt.
Weiterlesen: „Geraubte Kindheit, verlorene Identität“ – ein bewegender Dokumentarfilm in ukrainischer Sprache...


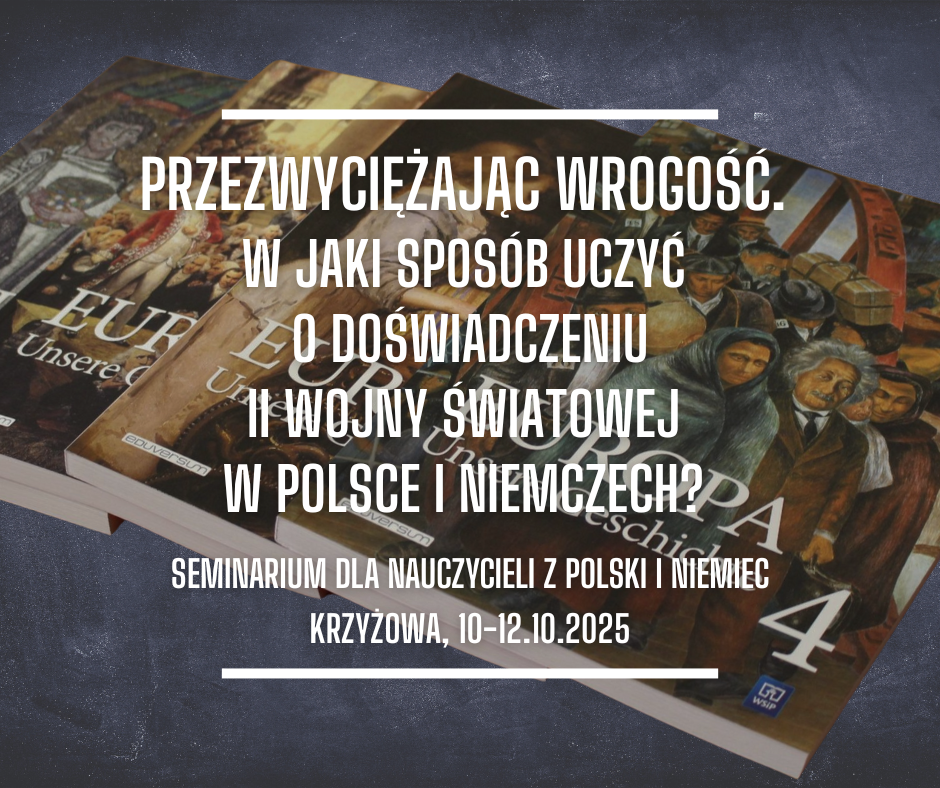


.png)

