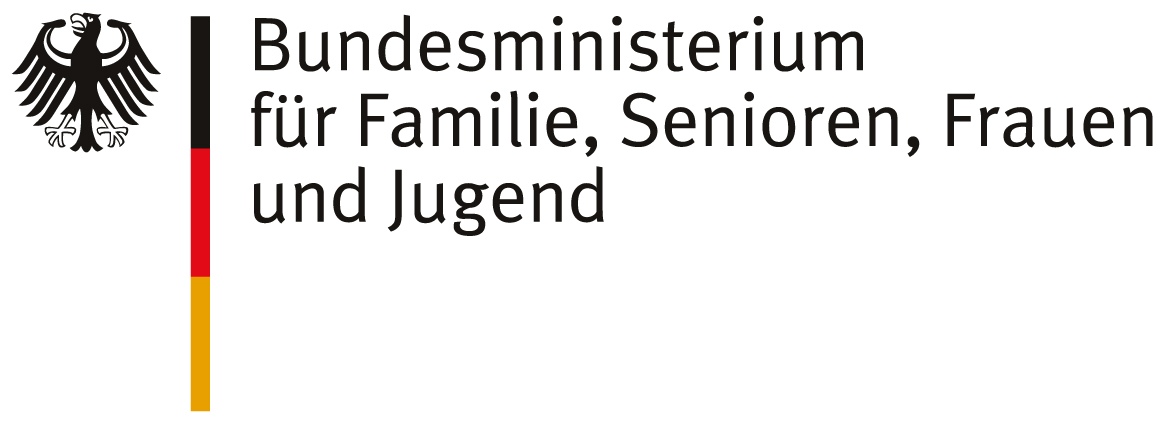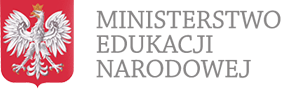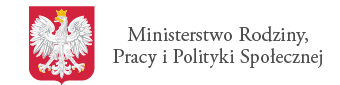Kreisau ist ein wichtiger Ort des deutsch-polnischen Dialogs. Nicht nur, weil dort am 12. November 1989 die Versöhnungsmesse statt fand. Einen wesentlichen Teil der Bedeutung von Kreisau als einem deutsch-polnischen Ort machen sowohl das beidseitige Entdecken Kreisaus, das Entdecken seines geistigen Vermächtnisses und die Stiftung selbst aus, die einen Raum des Dialogs für Jugendliche und Erwachsene vor allem aus Deutschland und Polen schafft und somit zu einem seiner relevanten Akteure geworden ist.
Kreisau ist ein wichtiger Ort des deutsch-polnischen Dialogs. Nicht nur, weil dort am 12. November 1989 die Versöhnungsmesse statt fand. Einen wesentlichen Teil der Bedeutung von Kreisau als einem deutsch-polnischen Ort machen sowohl das beidseitige Entdecken Kreisaus, das Entdecken seines geistigen Vermächtnisses und die Stiftung selbst aus, die einen Raum des Dialogs für Jugendliche und Erwachsene vor allem aus Deutschland und Polen schafft und somit zu einem seiner relevanten Akteure geworden ist.
Aber wie ist dieses kleine, ehemals deutsche Dorf in Niederschlesien zu einem Symbol des Dialogs und der deutsch-polnischen Aussöhnung geworden?
1945 wurde das deutsche Kreisau zum polnischen Krzyżowa. Seinen neuen Einwohnern – Polen, die aus den ehemaligen Ostgebieten der Zweiten Republik gekommen waren – waren Kreisau und seine Vergangenheit fremd. Mehr noch, die Vergangenheit dieses Ortes interessierte sie überhaupt nicht. Vor diesem Hintergrund stellt Kreisau einen Ort erzwungener deutsch-polnischer Begegnungen dar. Diese Begegnungen in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges und kurz nach dessen Ende lösten eher Irritationen und Ängste aus, die für die spätere Politik in den beiden deutschen Staaten und im kommunistischen Polen zu einem wichtigen Treibstoff der Propaganda wurden, mit dessen Hilfe ein deutsch-polnischer Anti-Dialog geführt sowie gegenseitiges Misstrauen in vielen darauffolgenden Jahren geschürt werden sollten.
Ungeachtet dieser politischen Probleme wurden die Mauern in den Köpfen von Anfang der 1960er Jahre an von mutigen Polen und Deutschen beiderseits der Oder nach und nach ins Wanken gebracht. Dabei strebten die Beteiligten nach einer Form des Dialogs, der nicht vor Themen zurückschreckt, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft berühren. Diese mutigen Polen und Deutschen, die in Polen im Umfeld katholischer Zeitschriften wie etwa „Znak”, „Więź” oder „Tygodnik Powszechny” wirkten und sich um die Klubs der Katholischen Intelligenz (KIK), in der DDR um die Aktion Sühnezeichen, in Westdeutschland wiederum um Pax Christi scharten, wussten, dass sie nicht die Mehrheit ihrer Gesellschaften repräsentierten. Ihnen war vielmehr klar, dass sie entgegen der Mehrheit und entgegen der jeweils herrschenden Meinung agierten, denn die Gegensätze, die auch aus den Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges herrührten, waren auf beiden Seiten sehr stark. Diejenigen, die diesen frühen deutsch-polnischen Dialog führten, wurden sowohl in Deutschland als auch in Polen sogar auf die eine oder andere Weise des Verrats bezichtigt. Manchmal geschah dies aus kaltem, tagespolitischen Kalkül, mitunter auch aus politischer oder moralischer Überzeugung. Um solche Anfeindungen zu ertragen, bedurfte es großen Mutes. Und dabei ist ein solcher Mut, den wir in der Stille unseres eigenen Zimmers – über ein Buch gebeugt und mit der Feder in der Hand – offenbaren, der Mut zu denken, bisweilen am schwierigsten aufzubringen.
Kreisau als Ort spielte in diesem Prozess keine Schlüsselrolle. In Kreisau kamen Ludwig Mehlhorn, Franz von Hammerstein oder Tadeusz Mazowiecki nicht zusammen. Aber indirekt setzten sie sich alle – jeder für sich – mit dem Erbe von Kreisau auseinander und standen mit diesem Ort in einem eigentümlichen Dialog, der sie in der Folge auf den deutsch-polnischen Dialog vorbereitete.
Für Tadeusz Mazowiecki, einen Publizisten und Oppositionellen, war dies möglich, weil Anna Morawska 1970 das Buch „Ein Christ im Dritten Reich” veröffentlichte. Mit diesem Buch brachte die katholische Intellektuelle ihren Lesern die Gestalt des evangelischen Geistlichen Dietrich Bonhoeffer näher, aber zugleich auch die Mitglieder des Kreisauer Kreises. Darin stellt sie die Frage nach der moralischen Kondition des Einzelnen in einem unfrei gewordenen Staat sowie nach der Rolle der Kirche in einer Situation, in der in einem Staat die Diktatur herrscht. Wie aktuell war doch diese Frage für polnische Oppositionelle, etwa Stanisław Stomma, Jan Józef Lipski oder Władysław Bartoszewski. Denn diese suchten im kommunistischen Polen nach Mustern und Vorbildern, wie man im eigenen Land in der Opposition sein könne und nicht mehr in der Opposition gegen eine fremde Besetzung. Tadeusz Mazowiecki schrieb eine nachdenkliche Rezension zum Buch von Morawska. Dabei interessierte ihn nicht nur die Frage, warum die meisten Deutschen Hitler erlagen und ihm folgten, und andere nicht, sondern vor allem die Frage: „Welche menschlichen Möglichkeiten gibt es, und wohin können sie in bestimmten Situationen führen?” Morawska und Mazowiecki zeigten den Polen, die nach einer inneren Freiheit und nach Konsequenz im Denken und Handeln suchten, auch „andere Deutsche”. Sie präsentierten Deutsche, die im Widerstand tätig gewesen waren, als potentielle Beispiele und stellten somit hohe intellektuelle, vor allem aber emotionale Anforderungen an die Polen. Sie taten dies gerade deshalb, weil ihnen bewusst war, dass nur auf diese Weise und durch diese Arbeit eine Vorbereitung auf den ethisch und geopolitisch notwendigen Dialog mit den Deutschen möglich sein würde.
Franz von Hammerstein brachte seine Erfahrung mit dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus gleichsam von Hause aus mit. Er selbst war von der Gestapo verfolgt worden, weil seine beiden Brüder an dem Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 beteiligt gewesen waren. 1957 gründete er zusammen mit Harald Poelchau das evangelische Bildungszentrum „Haus Kreisau” in Berlin, um auf diese Weise die Erinnerung an den Kreisauer Kreis in einer Gesellschaft zu pflegen, die die Verschwörer gegen Hitler immer noch als Verräter bezeichnete. Er fuhr nicht nach Polen, um das inzwischen verfallende Gut der Familie von Moltke zu retten, sondern ermunterte die Deutschen zum Dialog mit dem intellektuellen Nachlass von Kreisau. Kreisau hatte für ihn dabei eine doppelte Bedeutung: Es sollte ein Spiegel des deutschen Gewissens sein und zugleich zum Handeln im Sinne der Partizipation und der Demokratie inspirieren. Sein Engagement zielte nicht darauf ab, einen Tempel des reinen Gewissens der Deutschen zu errichten; ganz im Gegenteil. Er bemühte sich um die ständige Konfrontation mit dem Übel der deutschen Vergangenheit, um gemeinsam mit Opfern deutscher Verbrechen Dialog und Aussöhnung zu suchen. Deswegen engagierte er sich für die Aktion Sühnezeichen, die zunächst eine gesamtdeutsche Organisation war. Nach dem Bau der Berliner Mauer stand er in Westdeutschland an ihrer Spitze und setzte sich intensiv für die Gründung einer Internationalen Jugendbegegnungsstätte in Oświęcim ein. Im Jahre 1989 schließlich wurde er einer der Gründer des Vereins Kreisau-Initiative in Berlin.
Ludwig Mehlhorn wiederum reiste als Student in der DDR zu einem Sommerlager nach Polen, das dort von der Aktion Sühnezeichen Ost, die er seit 1968 kannte, als eine von zahlreichen Maßnahmen dieserart durchgeführt wurde. Er machte sich mit der polnischen Geschichte vertraut und lernte Polnisch. Nach seinem ersten Aufenthalt in Polen schrieb er: „Die Erfahrungen in Polen haben meine Wahrnehmung der DDR insofern verschärft, indem mir klar geworden ist, wie groß das Maß an Freiheitsbe-schränkung ist”. In dieser Zeit, im Rahmen der Evangelischen Hochschulgemeinde, entdeckte er auch Dietrich Bonhoeffer. Die polnische demokratische Opposition und der deutsche Widerstand gegen den Nationalsozialismus motivierten den jungen Mehlhorn dazu, oppositionelle Kreise in der DDR mit aufzubauen und einen aufrichtigen Dialog mit Polen zu beginnen. Hierzu baute er das Anna-Morawska-Seminar in Berlin auf und schuf so ein Forum für den Gedankenaustausch über drängende Fragen. Den tatsächlichen Ort Kreisau lernte er erst am 4. Juni 1989 kennen, als Leute, die sich für Kreisau engagierten, zum ersten Mal eben dort zusammenkamen. Ludwig Mehlhorn sagte dazu, dies sei für ihn ein Tag gewesen, an dem die Berliner Mauer symbolisch fiel. Es war auch ein Tag, an dem sich die intensiven Gespräche von Polen und von Deutschen über das Erbe von Kreisau in einen Dialog verwandelten über dessen Bedeutung für das sich vereinigende Europa.
Aus dieser Geschichte abzuleiten, Polen und Deutsche seien bis 1989 nicht in Kreisau zusammengekommen, entspricht nicht der Wahrheit. Die neuen Einwohner von Kreisau lernten mit der Zeit die Geschichte ihrer neuen Heimat kennen. Spätestens in den 1970er Jahren wurde ihnen klar, dass dies ein wichtiger Ort für das deutsche Selbstverständnis ist, als – zum Teil wegen des Generalfeldmarschalls, zum Teil wegen des Kreisauer Kreises – nach der Unterzeichnung des Vertrages über die Normalisierung der Beziehungen zwischen Polen und der BRD immer mehr Deutsche nach Kreisau kamen. Diesen Touristen standen die Polen misstrauisch gegenüber, denn sie hatten Angst, dass sie ihre neue Heimat erneut verlieren könnten. Doch im Rahmen angstbesetzter deutsch-polnischer Anti-Begegnungen tat sich eine Person hervor, die für Kreisau eine Schlüsselbedeutung einnehmen sollte: Prof. Karol Jonca. Dieser war Rechtshistoriker an der Universität Wrocław (Breslau) und befasste sich ursprünglich mit den Kriegskonzeptionen des Generalfeldmarschalls Helmuth von Moltke. Bei seinen Forschungen stieß er aber auch auf die Schriften des Kreisauer Kreises und war von diesen tief beeindruckt. Zunächst hatte er Schwierigkeiten, im kommunistischen Polen wissenschaftlich zum deutschen Widerstand zu veröffentlichen. Im Zuge der Entspannungspolitik während der 1970er Jahre aber erschienen seine Texte schließlich in gedruckter Form. Als er nach Kreisau kam, machte sich mit dem Gebäudekomplex und dem Familienfriedhof vertraut und war über deren Zustand bestürzt. In der Folge unternahm er gemeinsam mit dem Gemeindepfarrer von Grodziszcze, Bolesław Kałuża, zahlreiche Versuche, zu retten, was noch zu retten war. Zugleich interessierte sich für Kreisau auch die Familie von Moltke. Die Witwe des hingerichteten Helmuth James von Moltke war gerührt, dass sie Polen kennen-lernte, die sie in ihren Bestrebungen, eine Gedenktafel für ihren Mann in Kreisau anzubringen, unterstützen wollten. Dabei ging es ihr selbst um eine Würdigung, gewissermaßen um ein symbolisches Grab, denn ein tatsächliches existiert ja nicht. Die polnischen kommunistischen Behörden erteilten jedoch keine Genehmigung. Der Dialog scheiterte an ideologischen Bedenken. Und so waren es schließlich Prof. Karol Jonca, Pfarrer Bolesław Kałuża und Freya von Moltke, die einen echten deutsch-polnischen Dialog begannen – in Kreisau und über Kreisau.
Auch der Breslauer Klub der Katholischen Intelligenz (KIK) war sich darüber im Klaren, in einer Region tätig zu sein, die von deutscher Kultur geprägt war. So wurde er auch schnell zu einer wichtigen Adresse für diejenigen Deutschen, die um einen Dialog mit Polen bemüht waren. Das KIK-Büro und das Haus der Familie Czapliński bildeten dabei einen Raum, in dem nach einer gemein-samen Sprache gesucht wurde, mit der man die deutsch-polnische Vergangenheit und Zukunft beschreiben könnte. Die Teilnehmer dieser Begegnungen – Polen wie Deutsche – waren sich darüber klar, dass man eine gemeinsame Sprache nur dann finde, wenn man die Grenzen einseitiger Argumente überschreite, und wenn man dazu übergehe, im Gegenüber eine Dialoggemeinschaft aufzubauen.
Auf den Umbruch des Jahres 1989 waren die Menschen des deutsch-polnischen Dialogs auf beiden Seiten der Oder daher entsprechend vorbereitet. Sie waren sich zu dem Zeitpunkt, als die polnische Freiheit zur Voraussetzung wurde für die deutsche Wiedervereinigung und die deutsche Vereinigung ihrerseits zu einer solchen für die polnische Freiheit, einer einzigartigen Werte- und Interessengemeinschaft bewusst. Folglich plante der KIK für Juni 1989 eine Konferenz, zu der Teilnehmer aus Polen, der DDR, der Bundesrepublik, den Niederlanden und den USA anreisen sollten – Menschen, die sich stark machten für die Ret-tung von Kreisau und dessen geistigen Vermächtnisses. Das Konferenzdatum fiel mit dem Termin der ersten halbfreien Wahlen zum polnischen Parlament zusammen, die endgültig die Niederlage der Kommunisten besiegelten und den Weg Polens in einem freien Europa ebneten.
Auf dieser Junikonferenz wurde Kreisau zum ersten Mal gleichsam zu einem physischen Ort, zum Gegenstand und zum Ziel des deutsch-polnischen Dialogs der Zivilgesellschaft. Kreisau wurde zu einem wichtigen Ort für Menschen aus Polen und der DDR, die den deutsch-polnischen Dialog bis ins Jahr 1989 zugleich als eine Form der oppositionellen Tätigkeit betrachteten und zusammen mit ihren Freunden und Bekannten aus der Bundesrepublik, den Niederlanden und den USA für sich in Kreisau einen Raum für kreative Arbeit sahen, mit der die Spaltungen in Europa überwunden werden sollten.
Die Versöhnungsmesse vom 12. November 1989, die auf Anregung des polnischen Regierungschefs in Kreisau stattfand, und nicht auf dem Annaberg, wie es dem deutschen Kanzler ursprünglich vorgeschwebt hatte, veränderte die Bedeutung dieses Ortes nachhaltig. Die Erinnerung an den deutschen Widerstand sollte fortan nicht mehr die einzige Inspiration für den deutsch-polnischen Dialog und seiner Ausdehnung auf das sich vereinigende Europa bilden. Der Friedensgruß, den der erste nichtkommunistische Ministerpräsident Polens und der Kanzler des sich wiedervereinigenden Deutschlands austauschten, wurde schnell zum Symbol der deutsch-polnischen Versöhnung – oder, entsprechend einer weniger radikalen Lesart, zum Symbol für den Beginn einer neuen Etappe im deutsch-polnischen Dialog.
Doch was war die Versöhnungsmesse eigentlich? Wer versöhnte sich in Kreisau mit wem? Inwiefern ist die symbolische Bedeutung von Kreisau als einem Ort des deutsch-polnischen Dialogs nach der Versöhnungsmesse überhaupt legitim?
Die Versöhnungsmesse in Kreisau trägt den Stempel eines ungewollten Ereignisses und dies in hohem Maße deshalb, weil es sich dabei um einen politischen Kompromiss handelte – zwischen einer Messe in deutscher Sprache für die deutsche Minderheit unter Teilnahme von Helmut Kohl auf dem Annaberg und dem Fehlen jedweden symbolischen Zeichens, vor allem für Moskau und die westlichen Verbündeten, dass Polen und Deutsche sich durchaus verständigen können. Wichtig war dieses Versöhnungszeichen sowohl für Mazowiecki, dessen Regierung politische und finanzielle Unterstützung für notwendige Reformen benötigte, als auch für Kohl, der angesichts des Falls der Berliner Mauer hoffte, sein Land wiedervereinigen zu können, dafür aber Verbündete beiderseits der Grenzen eines wiedervereinten Deutschlands brauchte. Ist deshalb aber die Umarmung von Mazowiecki und Kohl lediglich als Ausdruck politischen Kalküls und mit Blick auf die internationale Politik zu bewerten?
Nein. Sowohl Kohl als auch Mazowiecki machten zuvor sehr deutlich, dass die Versöhnung zwischen den Polen und den Deutschen ein Ziel ihrer beider Regierungen sei, auch wenn beide sich den Prozess freilich anders vorstellten, denn jeder von ihnen brachte auch ein anderes Bewusstsein für politische Inszenierung mit. Kohl war Berufspolitiker und zu diesem Zeitpunkt bereits seit sieben Jahren Regierungschef in einem demokratischen Land. Mazowiecki hingegen war ein katholischer Intellektueller, der erstmalig und auch erst seit zwei Monaten eine Regierung anführte. Er unterhielt zahlreiche Kontakte zu Deutschen in Ost und West. Als Pole und Intellektueller spürte er, dass Versöhnung nottat, als Politiker aber fürchtete er sich auch vor ihr. Mazowieckis Angst vor einer politischen Versöhnung rührte daher, dass ein paar Kilometer von Kreisau entfernt noch die größte militärische Einheit der Sowjetarmee in Polen stationiert war. Er hatte Angst vor einer symbolischen Versöhnung, weil er angesichts der so großen politischen und wirtschaftlichen Asymmetrie zwischen Polen und Deutschland wohl nicht an deren Wahrhaftigkeit glaubte. Zudem wusste Mazowiecki wenig von politischer Öffentlichkeitsarbeit. Er wollte Politik so betreiben, als gäbe es keine Medien, keine Logik medialen Handelns. Und die Kommunisten, die immer noch wichtige Positionen in der Regierung und in den Sicherheitsbehörden besetzten, wollten derweil ihrerseits ganz sicher keine Versöhnungsgeste. So drängte der Sicherheitsdienst (SB), der noch dem kommunistischen Innenminister Czesław Kiszczak unterstellt war, bis zum letzten Moment Bischof Nossol, diesen Teil der Eucharistie auszulassen. Doch der Bischof lehnte dies entschieden ab. Und so wird heute, in der Rückschau, nicht zuletzt an diesen Umständen deutlich, dass viele Zeitgenossen damals nicht verstanden oder nicht verstehen wollten, was die Geste von Kohl und Mazowiecki in Kreisau bedeuten sollte.
Bei der Versöhnungsmesse anwesend waren neben einer Handvoll Prominenter, die hauptsächlich aus Deutschland mit der Delegation von Kanzler Kohl angereist waren, und einigen wenigen bekannten Persönlichkeiten aus Polen, vornehmlich Vertreter der deutschen Minderheit, die voller Befürchtungen nach Kreisau gekommen waren. Mit dem Ort verband sie nichts. Er war ihnen fremd; anders als der Annaberg. Und so wollten die nach Kreisau angereisten Vertreter der deutschen Minderheit Kohl ihre Enttäuschung darüber zeigen, dass er sich nicht um sie kümmere. Gleichzeitig wollten sie dem polnischen Ministerpräsidenten die Bitte vorbringen, ihre Bedürfnisse anzuerkennen. Mit wem sollten sich also die Vertreter der Minderheit, die voller Befürchtungen und Forderungen in Kreisau zugegen waren, versöhnen? Mit den Polen aus Kreisau, Świdnica (Schweidnitz) oder Grodziszcze (Gräditz)? Und mit wem sollten sich die Polen versöhnen, auch diejenigen vom Breslauer Klub der Katholischen Intelligenz, die sich seit den 1970er Jahren intensiv für eine deutsch-polnische Annäherung einsetzten, die wiederum den Angelegenheiten der Minderheit keine weiterreichende Bedeutung beimaßen?
„Die Versöhnung fand vor dem Altar statt, aber nicht auf dem Platz”, fasste es später Bernard Gaida, ein Vertreter der deutschen Minderheit, zusammen. „Ich hatte das Gefühl, dass da etwas Wichtiges geschah. Der Händedruck der beiden Regierungschefs. Was waren das für Emotionen”, erinnert sich Ewa Unger, die spätere Vorsitzende der Rates der Stiftung Kreisau für Europäische Verständigung. Die mit der Geste einhergehenden Emotionen waren stark und hingen sehr vom Engagement für den Dialog ab. Selbst wenn wir aus heutiger Sicht zu der Einschätzung gelangen, dass in Kreisau der polnische Idealist Mazowiecki und der deutsche Realpolitiker Kohl einen Friedensgruß austauschten, so wäre es doch ein weit gehendes Missverständnis, diese Geste und deren politische und gesellschaftliche Funktion infrage zu stellen. Warum? Weil es eine den Wert jeglicher zivilgesellschaftlicher Aktivitäten in Polen, in der Bundesrepublik und in der DDR missachten würde, die auf Aussöhnung ausgerichtet waren. Sie wurden von mutigen Polen und Deutschen unternommen, die mit ihrem Tun nach und nach die Einstellung ihrer Landsleute gegenüber den Nachbarn veränderten und dadurch auch indirekt die Versöhnungsmesse in Kreisau möglich machten.
Ministerpräsident Mazowiecki dachte in ethischen und politischen Kategorien, als er sich für Kreisau, den Ort des deutschen Widerstandes, als Ort für die Versöhnungsmesse entschied. Auf diese Weise wollte er unterstreichen, mit welchen Deutschen er sich eine Versöhnung wünscht und in welchem Europa er das freie Polen und das wiedervereinigte Deutschland sieht. Es ging um ein auf festen christlichen Fundamenten fußendes Europa, ein demokratisches und freies Europa, ein Europa, von dem die Mitglieder des Kreisauer Kreises und die polnische demokratische Opposition träumten. Kohl sah in Kreisau, und in den „anderen Deutschen”, eine Hoffnung darauf, dass die Last der Geschichte überwunden und die Frage der nicht verarbeiteten gemeinsamen tragischen Vergangenheit ein für alle Mal abgeschlossen war.
Trotz fundamentaler Unterschiede in den Handlungsmotiven der beiden Politiker steht Kreisau für die deutsch-polnische politische Annäherung, denn mit der Bewusstwerdung der Unterschiede fängt der Dialog als Voraussetzung für Versöhnung und Partnerschaft an. In Kreisau nahm der politische Dialog eines neuen, sich langsam von der kommunistischen Herrschaft befreienden Polens und eines sich wiedervereinigenden Deutschlands seinen Anfang. Ein schwieriger und mühsamer Dialog, der aber auch verschiedene Standpunkte und Interessen miteinander vereinte und damit auf Partnerschaft zielte. Die Versöhnungsmesse vom 12. November 1989 hatte eine wegweisende Bedeutung für die Bereinigung der deutsch-polnischen Emotionen. Zudem wurde sie an einem Ort gehalten, an dem der Dialog über die weltanschaulichen Unterschiede hinweg bereits eine Tradition hatte. Und der Gottesdienst machte Polen und Deutschen auch klar, dass Feindschaft und Kälte an einem solchen Ort überwunden werden können.
So steht die Versöhnungsmesse in Kreisau für den politischen Willen, den deutsch-polnischen Dialog ohne Einschränkungen und für jeden zu öffnen. Der Friedensgruß von Kreisau sagt uns auch, dass Polen und Deutsche darüber, was sie trennt und verbindet – wie auch über die Zukunft Europas – ins Gespräche kommen wollen, konnten und auch sollen. Die Autoren Żurek und Olschowski haben recht, wenn sie Folgendes anmerken: „Die Kreisauer Versöhnungsmesse ist ein Zeichen für die Bewältigung des ‚Fatalismus der Feindschaft‘, der das Fundament des geeinten Europas bildete. Gleichzeitig ist sie ein Zeugnis dafür, dass die Wende größtenteils normalen Menschen zu verdanken ist. Der deutsch-polnische Aussöhnungsprozess, den lange Zeit kleine, aber fest entschlossene Gruppen getragen haben, zeigt uns den Sinn und die Wirksamkeit der Aktivitäten von Zivilgesellschaften. Ohne sie gäbe es keine Europäische Union, und das ist die zweite Botschaft der Versöhnungsmesse.“
Ein Symbol der Stärke und Entschlossenheit, zugleich aber auch ein lebendiges und sichtbares Zeichen des zivilgesellschaftlichen deutsch-polnischen Dialogs, ist die im Jahr 1990 entstandene Stiftung Kreisau für Europäische Verständigung. Als unabhängige Nichtregierungsorganisation mit dem Schwerpunkt der Bildungsarbeit knüpft sie seitdem zugleich an das Vermächtnis des deutschen Widerstandes wie auch die deutsch-polnische Versöhnung an. Die in Kreisau stattfindenden Treffen von Jugendlichen, vor allem aus Polen und Deutschland, sowie die zahlreichen Programme im Bereich historischer, politischer und interkultureller Bildung, die sich an verschiedene Zielgruppen richten, sind auch eine wichtige Plattform für den deutsch-polnischen Dialog. Diese
Arbeit wird aber auch von mehreren anderen, ebenso wichtigen Bildungseinrichtungen geleistet. Worin besteht somit die Besonderheit von Kreisau als einem Ort des deutsch-polnischen Dialogs in pädagogischer Hinsicht? Kreisau ist ein Ort authentischer Begegnungen, die die Strahlkraft des Dialogs deutlich machen: drei Tagungen des Kreisauer Kreises und die deutsch-polnische Versöhnungsmesse. Die intellektuelle Spannung zwischen diesen beiden sehr intimen Erfahrungen schafft für Polen und Deutsche einzigartige Bedingungen, nicht nur für die Besonderheit des deutsch-polnischen Dialogs und seine zahlreichen Schwierigkeiten, sondern auch – in einem tieferen Sinne – für die Frage, warum die europäische Verständigung so ein schwieriger Prozess ist. In Kreisau findet, oft unbewusst, bei zahlreichen internationalen Jugendbegegnungen ein ständiger Dialog über das vielfältige Erbe statt. Sie sind weder für die Teilnehmer des Jugendaustauschs noch für Kreisau selbst von untergeordneter Bedeutung.
Denkt man über die Bedeutung des heutigen Kreisau nach, so ist die Berücksichtigung kritischer Stimmen sinnvoll: Kreisau sei ein kleines Licht in der dunklen deutschen Geschichte und der Mythos der deutsch-polnischen Versöhnung solle dabei nur Deutschland reinwaschen. Wozu sollten wir, die Polen, nun also eben dieses klitzekleine Kapitel ihrer Geschichte lancieren? Selbstverständlich wäre es uns lieber, wenn die Deutschen mehr über Polen und die Geschichte der Polen unter der deutschen oder der sowjetischen Besatzung wüssten, denn das liegt auch in ihrem Interesse. Und gerade bei der Geschichtsvermittlung spielt Kreisau eine große Rolle – eben als Ort des deutsch-polnischen Dialogs. Wenn wir die Geschichte von Kreisau im breiten Kontext erzählen und dabei keine Berührungsängste haben, finden wir genug Platz für die Geschichte des deutschen Widerstands sowie der polnischen demokratischen Opposition und des Polnischen Untergrundstaates aus den Zeiten des Zweiten Weltkrieges. Erheben wir Kreisau hingegen zum Aushängeschild deutscher Anständigkeit bzw. eines ruhigen deutschen Gewissens, so berauben wir uns der Möglichkeit, einen echten und aufrichtigen Dialog über den Krieg und die deutschen Verbrechen zu führen.
Es ist ein Thema, über das aufgeschlossene Polen und Deutsche seit Mitte der 1960er Jahre sprechen und auch immer wieder sprechen werden, und zwar nicht deshalb, weil die Polen auf diese Weise etwas gegen ihre Komplexe tun wollten. Diese Denkweise ist falsch und verschließt die Dialogbereitschaft auf beiden Seiten. Zu bedenken gilt es stattdessen: Die Folgen des Krieges sind in Polen nach wie vor spürbar und in der Erinnerung von Familien stets lebendig. Eben deshalb sind die allgemeine Ignoranz und das Unverständnis unter den Deutschen (vereinfacht gesagt: der Nachfahren der Täter) heute für die Nachkommen der Opfer so schmerzhaft. Diese unterschiedlichen Erfahrungen und auch Geschichtsbilder bedürfen immer noch eines Raumes für Dialog, den Kreisau bildet und weiterhin auf Jahre hinaus bilden sollte.
In diesem Sinne weist Kreisau als ein Symbol für Versöhnung eine andere Logik auf als Symbole der deutsch-französischen Versöhnung, etwa Reims oder Verdun. Der Friedensgruß, den Ministerpräsident Mazowiecki und Bundeskanzler Kohl austauschten, bildete keine Prämisse dafür, den vom polnischen und deutschen Leid geprägten Ort, des Ortes, an dem deutsch-polnische Wunden heilen, neu zu bewerten und hier eine Umwertung vorzunehmen. Mazowiecki hatte mit seinen Ängsten vor einem derartigen Symbol Recht. Für eine solche Geste war es womöglich zu früh. Erst 2014 umarmten sich auf der Westerplatte die Präsidenten Polens und Deutschlands, Bronisław Komorowski und Joachim Gauck. Zuvor hatten sich am 1. September 1999 bei den offiziellen Feierlichkeiten anlässlich des Jahrestages des deutschen Überfalls auf Polen Władysław Stopiński, einer der Verteidiger der Wester-platte, und Martin Menzel, der als Richtkanonier auf der „Schleswig-Holstein“ Dienst tat, zum Zeichen der Versöhnung die Hände gereicht.
Kreisau bleibt in diesem Sinne als Ort des deutsch-polnischen Dialogs ein ständiger Appell und sein symbolischer Friedensgruß kann als Versprechen gedeutet werden – ein Versprechen zum Dialog über das Vermächtnis des Kreisauer Kreises, die demokratische Opposition in den Ländern Mittel- und Osteuropas und das Vermächtnis der deutsch-polnischen Versöhnung.
Auf der deutsch-polnischen Erinnerungskarte gibt es keinen Ort, an dem das individuelle Sinnieren über Mut und Versöhnung, zugleich aber auch eine Diskussion über die Zukunft und die Vergangenheit der deutsch-polnischen Beziehungen in dem von verschiedenen Herausforderungen geplagten Europa so einzigartig und bedeutend wären wie in Kreisau.
Deshalb besteht die Bedeutung von Kreisau als einem Ort des deutsch-polnischen Dialogs nicht nur darin, dass sie die Geste des Friedensgrußes von Ministerpräsident Mazowiecki und Bundeskanzler Kohl sowie die Geschichte der deutsch-polnischen Versöhnung als ein in gewissem Maße bereits erfülltes Anliegen würdigt und die Erinnerung daran wachhält. In Kreisau wird uns zudem bewusst, dass Versöhnung darin besteht, immer wieder nach einer gemeinsamen Sprache zu suchen, um damit über die schwierige Vergangenheit zu sprechen und dort nach Verständigung zu suchen, wenn es Politikern daran mangelt, und immer wieder Menschen zusammenzubringen, die Grenzen überwinden und in eine Dialoggemeinschaft treten mit scheinbar Fremden. Kreisau muss als ein Symbol für die deutsch-polnische Versöhnung ein lebendiger Ort der Diskussion bleiben. Von solchen gibt es immer weniger, und es zeigt sich, dass Versöhnung nach wie vor eine große und aktuelle Notwendigkeit darstellt – in individueller, religiöser, politischer und kultureller Dimension.
Der Text wurde im Rahmen des Projektes „Das Erbe der deutsch-polnischen Aussöhnung und der Aufbau eines wertebasierten Europas” erstellt, das von der Stiftung Kreisau für Europäische Verständigung in Zusammenarbeit und mit Unterstützung der Konrad-Adenauer-Stiftung in Polen sowie des Zentrums „Erinnerung und Zukunft“ (Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”) durchgeführt wurde. Er wurde veröffentlicht in: (Un)versöhnt? Gedanken über die deutsch-polnischen Beziehungen nach 1945, Tomasz Skonieczny (Hg.), Wrocław 2019.









.jpg)



.png)
.png)








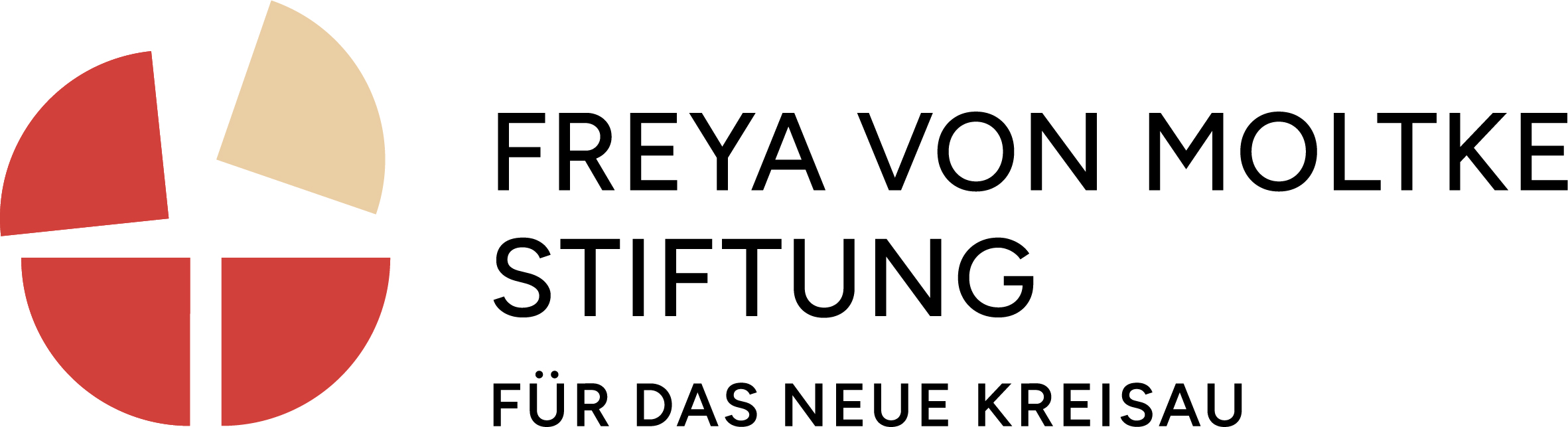
.jpg)