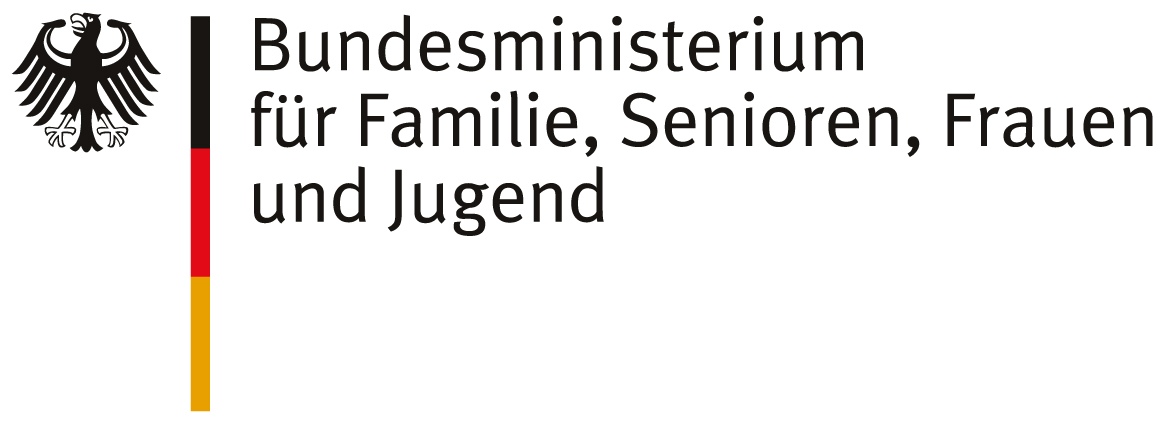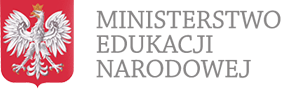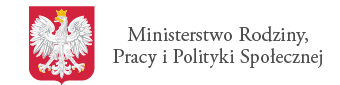Am 4. Juni 1989 fanden in Polen die ersten teilweise freien Wahlen statt. Am selben Tag wurden in Peking friedliche Proteste chinesischer Studenten vom Militär brutal niedergeschlagen. Drei Monate später begann der Eiserne Vorhang offensichtlich immer durchlässiger zu werden. Am 7. Oktober 1989 wurde in Ostberlin der 40. Jahrestag der DDR-Gründung noch pompös gefeiert – unter den Gästen von Erich Honecker befanden sich auch Michail Gorbatschow, Wojciech Jaruzelski, Todor Schiwkow und Nicolae Ceaușescu. Aber bereits zwei Monate später wurde der rumänische Diktator im Zuge der revolutionären Wirren in einem spektakulären Schauprozess zum Tode verurteilt und hingerichtet. Mit diesem dramatischen Akzent ging das ereignisreiche Jahr 1989 zu Ende. Bereits zuvor hatten Berliner Bürger in der Nacht vom 9. auf den 10. November die trennende Grenzmauer in einer spontanen Aktion zu Fall gebracht. Diese Mauer war das markante Symbol des Eisernen Vorhangs, der Europa seit 1945 in zwei feindliche politische Blöcke gespaltet hatte. Bereits am 12. November fand im kleinen niederschlesischen Dorf Kreisau eine Heilige Messe statt, die von Politikern und Journalisten noch am selben Tag als „Versöhnungsmesse“ bezeichnet wurde.
Am 4. Juni 1989 fanden in Polen die ersten teilweise freien Wahlen statt. Am selben Tag wurden in Peking friedliche Proteste chinesischer Studenten vom Militär brutal niedergeschlagen. Drei Monate später begann der Eiserne Vorhang offensichtlich immer durchlässiger zu werden. Am 7. Oktober 1989 wurde in Ostberlin der 40. Jahrestag der DDR-Gründung noch pompös gefeiert – unter den Gästen von Erich Honecker befanden sich auch Michail Gorbatschow, Wojciech Jaruzelski, Todor Schiwkow und Nicolae Ceaușescu. Aber bereits zwei Monate später wurde der rumänische Diktator im Zuge der revolutionären Wirren in einem spektakulären Schauprozess zum Tode verurteilt und hingerichtet. Mit diesem dramatischen Akzent ging das ereignisreiche Jahr 1989 zu Ende. Bereits zuvor hatten Berliner Bürger in der Nacht vom 9. auf den 10. November die trennende Grenzmauer in einer spontanen Aktion zu Fall gebracht. Diese Mauer war das markante Symbol des Eisernen Vorhangs, der Europa seit 1945 in zwei feindliche politische Blöcke gespaltet hatte. Bereits am 12. November fand im kleinen niederschlesischen Dorf Kreisau eine Heilige Messe statt, die von Politikern und Journalisten noch am selben Tag als „Versöhnungsmesse“ bezeichnet wurde.
Wenn Geschichte zu rasen beginnt
Die Ereignisse in der zweiten Jahreshälfte 1989 wurden von zahlreichen Kommentatoren als europäischer „Völkerherbst“ bezeichnet. In Polen offenbarte die politische Entwicklung bereits im Januar 1989 durch erste Gespräche der Opposition mit Vertretern der Staatsmacht eine unerwartete Dynamik. Denn in Magdalenka bei Warschau vereinbarte man damals den Beginn der Beratungen am sog. „Runden Tisch“, die dann im Juni zu den ersten teilweise freien Parlamentswahlen nach 1945 (sog. „Kontrakt-Sejm“ und Senat) führten. Im August wurde Tadeusz Mazowiecki – ehemaliger „Znak”-Abgeordneter, katholischer Christ, Mitglied der Solidarność-Opposition und Chefredakteur der nach den Juniwahlen wiedergegründeten Wochenzeitung „Tygodnik Solidarność ” – mit der Regierungsbildung in Polen beauftragt. Die Lage im Lande begann sich spürbar zu verändern. Daraufhin statteten der französische Staatspräsident François Mitterand und US-Präsident George Bush dem neuen demokratischen Polen eine offizielle Visite ab. Für November war hingegen ein Staatsbesuch von Bundeskanzler Helmut Kohl geplant. Auf dem Weg der sich abzeichnenden grundlegenden politischen Neuordnung Europas gehörte gerade dieser Polenbesuch zu den wichtigsten Etappen. Bereits im September 1989 hatte Helmut Kohl in seiner Bundestagsrede zum 50. Jahrestag des Ausbruchs des Zweiten Weltkrieges einerseits die Leiden der deutschen „Vertriebenen” herausgestellt, aber zugleich auch von der unabdingbaren Notwendigkeit einer nachhaltigen deutsch-polnischen Verständigung gesprochen. Als Vorbild nannte er dabei die Errungenschaften der freundschaftlichen politischen Beziehungen zwischen Bonn und Paris.
Der Bundeskanzler wusste um die Bedeutung von öffentlichen Gesten. Als er im September 1984 auf den ehemaligen Schlachtfel-Wenn aus Gesten große Politik erwächst dern von Verdun mit Staatspräsident Mitterand zusammenkam, gingen die Bilder beider Politiker um die Welt, als sie Hände haltend zum Zeichen von Frieden und Eintracht an den Massengräbern der dort gefallenen Soldaten standen. Die deutsch-französische Versöhnung wurde seither im politisch-gesellschaftlichen Bereich, aber auch im Mediensektor zunehmend Wirklichkeit. Denn auf die Versöhnungsgeste in Verdun folgten konkrete, gemeinsame Maßnahmen, wie z.B. die Gründung des Fernsehsenders Arte, der Vertrag von Maastricht oder die Einführung der gemeinsamen europäischen Währung EURO.
Tadeusz Mazowiecki, der erste nichtkommunistische Ministerpräsident Polens nach 1945, wusste genau, dass die Frage der Westgrenze seines Landes angesichts der 1989 entstandenen neuen Lage in Europa eine politische Schlüsselrolle spielte. Denn die Westgrenze Polens war zwar im Warschauer Vertrag von 1970 seitens der VR Polen und der Bundesrepublik bis auf Weiteres rechtlich anerkannt worden. Durch den Untergang der VR Polen, die Wiedervereinigung Deutschlands und den endgültigen Zusammenbruch der Nachkriegsordnung von Jalta konnte jedoch eine einseitige Aufkündigung des Warschauer Vertrags nicht ausgeschlossen werden. Auf diese neue bilaterale Konstellation ging Ministerpräsident Mazowiecki in seiner Regierungserklärung vom 12. September 1989 wie folgt ein: Wir brauchen eine Wende in den Beziehungen zur Bundesrepublik Deutschland. Die Bevölkerungen beider Länder sind bereits viel weiter gegangen als ihre Regierungen. Wir hoffen auf einen deutlichen Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen, und wir wollen eine echte Versöhnung, so wie sie zwischen Deutschen und Franzosen eingetreten ist. Diese Äußerungen standen in Einklang mit den Worten Kohls vom 1. September 1989. Nun kam es auf den daraufhin geplanten Besuch des Bundeskanzlers in Polen an.
St.-Anna-Berg oder Kreisau?
Die Gespräche über den geplanten Polenbesuch Helmut Kohls wurden bereits von der letzten kommunistischen Regierung unter Mieczysław Rakowski aufgenommen, der im August 1989 sein Amt an Tadeusz Mazowiecki abtrat. Im Juli hatte sich auch der Bischof von Opole/Oppeln, Alfons Nossol, in die Vorbereitungen dieses Besuchs eingeschaltet. Er schlug dem Bundeskanzler die Teilnahme an einer für die deutsche Minderheit gefeierten Heiligen Messe auf dem oberschlesischen St.-Anna-Berg vor – in deutscher Sprache und mit Einverständnis des Primas von Polen, Kardinal Józef Glemp. Dieser Vorschlag zeugte unübersehbar vom Anbruch einer neuen Ära im deutsch-polnischen Verhältnis. Denn bislang existierte die deutsche Minderheit in Polen gar nicht. Jegliche Assoziationen zu den beiderseitigen Beziehungen weckten weitgehend Angst und Misstrauen in der Gesellschaft, eine Haltung, die von den kommunistischen Machthabern bewusst geschürt wurde. Kohl nahm die Einladung zur Messe an. Er ging dabei davon aus, dass er auf diese Weise nicht nur die deutsche Minderheit unterstützen würde. Denn der deutsche Regierungschef erhoffte sich vom St.-Anna-Berg zunächst eine ähnlich symbolträchtige Funktion wie beim Treffen in Verdun 1984. Rasch stellte sich jedoch heraus, dass eben die historische Symbolik des St.-Anna-Bergs zum erheblichen Streitpunkt in den beiderseitigen Verhandlungen wurde. Mazowiecki hegte nach Übernahme der Regierungsgeschäfte nichtsdestotrotz keinen Zweifel darüber, dass die Vorbereitungen zum geplanten Kohl-Besuch unbedingt fortgesetzt werden mussten. Daher betraute er Mieczysław Pszon, Redaktionsmitglied der katholischen Krakauer Wochenzeitung „Tygodnik Powszechny” mit der Organisation dieses Besuches. Pszon sollte fortan zusammen mit Horst Teltschik, dem Sonderbeauftragten der Bundesregierung für die Verhandlungen mit Polen, die mühsamen Vorbereitungen dazu treffen.
Die diesbezüglichen Gespräche und Vereinbarungen hätten sicherlich in der vertraulichen Abgeschiedenheit diplomatischer „Hinterzimmer“ stattfinden müssen. Doch bald erschien sowohl in deutschen als auch polnischen Medien eine Reihe von Beiträgen, die die Bedeutung des anstehenden Polenbesuchs von Bundeskanzler Kohl ausführlich erörterten. Mieczysław Pszon erinnerte sich daran wie folgt:
Schlimmer war, dass man gleichzeitig das voraussichtliche Besuchsprogramm veröffentlichte. Es war von Mitarbeitern des polnischen Außenministeriums, angeblich nach Mazowieckis Anweisungen sowie unter Berücksichtigung der Wünsche der deutschen Seite, das heißt von Beamten der Botschaft in Warschau, ausgearbeitet worden. Und dieses Programm enthielt ein Treffen mit der deutschen Minderheit auf dem Annaberg. Dieses Treffen wurde von Minister Skubiszewski bestätigt, der sich zu dieser Zeit gerade im Westen, vermutlich sogar in der Bundesrepublik, aufhielt. Bei seiner Rückkehr nach Polen tobte bereits eine Debatte um den Annaberg. Denn die deutschen Schlesier waren entschieden dafür, die polnischen Schlesier hielten es für eine Provokation. Für die Deutschen ist der Annaberg vor allem ein religiöser Ort. Für die Polen ist es der Ort des Kampfes gegen die Deutschen, Symbol der Schlesischen Aufstände usw. Was die Deutschen gar nicht wussten, obwohl sie es hätten wissen müssen, denn sie hatten uns dort eins auf ein bestimmtes Körperteil gegeben Außerdem gab es die deutschen Revisionisten. Doch Kohl beharrte auf dem Annaberg.
In den deutschen Medien tauchten Kommentare auf, die Kohl vorwarfen, dass es ihm an politischer Sensibilität fehle. Moniert wurde ferner, dass die Bundesrepublik dem polnischen Staat Wirtschaftshilfen in Millionenhöhe in Aussicht stelle, dieser aber in der Frage der Heiligen Messe auf dem St.-Anna-Berg nicht nachgeben wolle. Die Regierung in Warschau stand somit vor einer unerwarteten Herausforderung. Denn man rechnete tatsächlich mit einer großzügigen finanziellen Unterstützung von deutscher Seite, die es Polen erlauben würde, die nötigen inneren Reformen durchzuführen. Zudem erhoffte man sich eine endgültige Regelung zur wichtigen Frage der Oder-und-Neiße-Grenze sowie eine bilaterale Vereinbarung zur Entschädigung polnischer Opfer des NS-Regimes. Mazowiecki war sich aber bewusst, dass die Anwesenheit des Bundeskanzlers bei der in deutscher Sprache geplanten Messe für die deutsche Minderheit auf dem St.-Anna-Berg in der polnischen Öffentlichkeit schlecht ankommen und mit Sicherheit dazu missbraucht werden würde, die neue demokratische Regierung propagandistisch zu verunglimpfen. In Warschauer Regierungskreisen wurde vor allem befürchtet, dass die nationalkommunistische „Patriotische Vereinigung Grunwald“ im Zuge einer solchen Messe landesweite Gegenproteste organisieren könnte.
Die Lage schien zunächst aussichtslos. Aber dann wurde unverhofft während einer Beratung mit Ministerpräsident Mazowiecki doch noch ein Ausweg gefunden wurde.
Bei einem Treffen mit Mieczysław Pszon in der Kanzlei des Ministerpräsidenten Mazowiecki kam uns gemeinsam in den Sinn, dass es sinnvoll wäre, die Heilige Messe unter Teilnahme der beiden Regierungschefs in Kreisau zu veranstalten, wenn nun mal der St.-Anna-Berg nicht als Ort der Begegnung der Chefs der polnischen und der deutschen Regierung in Frage kommt – erinnerte sich Bischof Nossol rückblickend.
Entscheidungen wie folgt im Gedächtnis geblieben:
Ich kann mich an ein Gespräch mit Tadeusz Mazowiecki erinnern: Welchen Ausweg soll man [hier denn] finden? Einen Tag darauf kam er wohl auf die Idee mit Kreisau in Niederschlesien. Dass es zwar ein Treffen mit schlesischen Deutschen geben dürfe, aber auf einer anderen Ebene. Jetzt gehe es darum, dass dies von Bonn akzeptiert wird. Tadeusz versprach, sich zu überlegen, welche Bemühungen dabei zu unternehmen waren, verbot aber, irgendetwas darüber weiterzuerzählen. Ich ging zurück ins Hotel, es war Freitag oder Samstag. Und ich beschloss, Horst Teltschik zu Hause anzurufen. Ich sagte ihm, dass unsere ganze Arbeit möglicherweise futsch sei. Obwohl unser Ziel mit gutem Ergebnis für beide Seiten eigentlich erreicht sei, werde jetzt dennoch alles durch die Sturheit in der Frage des St.-Anna-Bergs zunichtegemacht. Ich bat ihn, zunächst einmal niemandem davon zu erzählen, dass wir angesichts dessen Kreisau vorschlagen. Teltschik hat von Kreisau [noch] nie in seinem Leben [etwas] gehört… Er nahm meine Argumentation an, meinte aber, dass die Entscheidung nicht in seiner Macht liege. Wir verblieben so, dass die Regierungschefs das selbst besprechen müssten.
Am nächsten Tag bin ich bei Mazowiecki. Er ruft Kohl an, oder Kohl ihn, ich weiß es nicht mehr. Plötzlich sagt Tadeusz: „Gut, wenn es diesen Vorschlag gibt, dann muss ich mir das überlegen, im Prinzip bin ich aber einverstanden”. Sie beenden das Gespräch und er ruft mir zu: „Hör mal, dieser Kohl ist verrückt geworden. Er legt mir nahe, unser deutsch-polnisches Treffen in Kreisau zu machen und schlägt vor, dass Bischof Nossol es in die Hand nehmen soll. Na, der Heilige Geist hat da wohl gewirkt”.
Schierer Wahnsinn?
Für Kreisau sprach vieles – mit diesem kleinen Dorf bei Świdnica/ Schweidnitz war die Adelsfamilie von Moltke verbunden. Wichtiger als der preußische Feldmarschall Helmuth Karl Bernhard von Moltke, der neben Bismarck als zweiter „Reichsschmied” gilt, war im Kontext des geplanten Zusammentreffens der Regierungschefs Polens und Deutschlands aber der Urenkel seines Bruders, Helmuth James. Denn Helmuth James von Moltke war einer der Mitbegründer des Kreisauer Kreises, einer NS-Widerstandsorganisation, die eine kleine Gruppe deutscher Intellektueller um sich versammelte. Diese Gruppe war sich der Verbrechen des Dritten Reiches und der diesbezüglichen Notwendigkeit von Sühne und Wiedergutmachung voll bewusst. Diese ethische Haltung erwies sich aus polnischer Sicht als überaus wichtig.
Die Wahl Kreisaus zum Begegnungsort kam für viele Beobachter zunächst überraschend. Die Geschichte des Kreisauer Kreises war zwar Mitgliedern des Klubs der Katholischen Intelligenz (KIK) in Breslau und dem verdienstvollen Historiker Prof. Karol Jonca bekannt, der seit den 1970er Jahren Freya von Moltke bei ihren Bemühungen unterstützte, ihren im Januar 1945 vom NS-Regime im Gefängnis Berlin-Plötzensee hingerichteten Mann Helmuth James auf dem Anwesen bei Świdnica/Schweidnitz historisch zu würdigen. Abgesehen davon hatte Tadeusz Mazowiecki bereits als Chefredakteur der katholischen Monatszeitschrift „Więź“ Ende 1971 eine umfangreiche Rezension zu Anna Morawskas Biographie „Dietrich Bonhoeffer. Ein Christ im Dritten Reich” verfasst. Die Teilnehmer der vom 2. bis 4. Juni 1989 in Breslau stattfindenden Konferenz „Der Christ in der Gesellschaft” besuchten auch das ehemalige Gutsgelände in Kreisau und richteten dabei einen offiziellen Appell an das polnische und das deutsche Außenministerium, in Kreisau ein internationales Jugendbegegnungszentrum sowie ein Museum zur Geschichte der europäischen NS-Widerstandsbewegungen zu errichten. Allerdings bildeten die Klubs der Katholischen Intelligenz in Polen elitäre, kleine Zirkel von gebildeten Laienkatholiken, die lediglich über geringe Einflussmöglichkeiten in der Gesellschaft verfügten. Nicht anders verhielt sich die Lage in der damaligen Bundesrepublik, wo die Geschichte des Kreisauer Kreises bislang keinen Eingang ins breite öffentliche Bewusstsein gefunden hatte.
Doch nichtsdestotrotz war Anfang November 1989 die Entscheidung endgültig gefallen. Die Heilige Messe sollte in der Ortschaft Kreisau stattfinden, die für ein solches Großereignis völlig unvorbereitet war. Der Gemeindepfarrer aus dem nahe gelegenen Grodziszcze/Lampersdorf, Pfarrer Bolesław Kałuża, erfuhr erst am 5. November von diesem Vorhaben. Die gesamte organisatorische Last fiel auf die Schultern des Breslauer Klubs der Katholischen Intelligenz (KIK), der jedoch mit der Unterstützung des Wojewoden von Wałbrzych/Waldenburg rechnen konnte.
Es waren kalte Novembertage. Das für den Gottesdienst gewählte Anwesen gehörte zu einem inzwischen verfallenen Staatlichen Landwirtschaftsbetrieb (PGR), was zusätzliche Probleme mit sich brachte. Denn wie sollte man das Gelände für die Messe herrichten, damit die Gäste später nicht mit schlechten Eindrücken abreisten?
Viele Tage lang schaffte das Militär Sand auf den riesigen Hof des ehemaligen Familienguts der Moltkes heran und bestrich die Wände mit Kalk. Die Löcher in den Dächern wurden eiligst mit dem geflickt, was gerade zur Verfügung stand. Aus Balken und Sperrholz errichtete man halbwegs provisorisch eine offene Kapelle, in der der historische Versöhnungsgottesdienst unter Teilnahme des polnischen Ministerpräsidenten, des deutschen Kanzlers und dreier Bischöfe stattfinden sollte – schrieb die Redakteurin Nina Kracherowa in der kommunistischen Tageszeitung „Trybuna Opolska”. Bei den „vielen Tagen” handelte es sich aber in Wirklichkeit gerade einmal um eine Woche. Die Messe sollte am 12. November abgehalten werden, also einen Tag nach dem zum ersten Mal seit Ende des 2. Weltkrieges begangenen nationalen Feiertag zum Gedenken an die Wiedererlangung der staatlichen Unabhängigkeit Polens am 11. November 1918. Niemand konnte jedoch vorhersehen, dass das geplante bilaterale Treffen gleichsam durch die Laune der Geschichte einen etwas anderen Verlauf nahm als erwartet.
Bundeskanzler Kohl traf am 9. November in Polen ein. Noch am selben Abend wurde völlig überraschend in Ostberlin die DDR-Grenze zum Westen geöffnet und die Mauer, die Europa über ein halbes Jahrhundert lang auf augenfällige Weise trennte, kam zu Fall. Kohl befand sich zu diesem Zeitpunkt auf einem gemeinsamen Staatsbankett mit seinem polnischen Amtskollegen. Angesichts des plötzlichen Mauerfalls beschloss Kohl, nach Berlin zurückzukehren, um eine Ansprache vom Balkon des Schöneberger Rathauses zu halten, wo sich Tausende von Deutschen spontan versammelten hatten. Dabei war sich der Bundeskanzler zunächst nicht sicher, ob er nach seiner Rede erneut nach Polen kommen würde, obwohl der unterbrochene Besuch in Warschau angesichts der sich überstürzenden Ereignisse immer mehr an Bedeutung gewann. Am 11. November reiste Kohl abends doch noch zurück nach Warschau. Dabei mischte sich noch das Wetter in die Politik ein, als ob es nicht schon genug Turbulenzen gegeben hätte. Denn in der Nacht zum 12. November hüllte den Warschauer Flughafen unerwartet dichter Nebel ein, so dass alle Flüge eingestellt werden mussten. Mazowiecki brach somit mit der Bahn nach Kreisau auf, während Kohl in einer Buskolonne anreiste.
„Gebt einander ein Zeichen des Friedens!“
Es ist bis heute kaum bekannt, dass am 12. November 1989 über 8.000 Menschen in das kleine Kreisau kamen – vor allem Vertreter der deutschen Minderheit, die zum ersten Mal seit 1945 lautstark an ihre Rechte erinnern konnten. Auf deutschsprachigen Transparenten wurde dabei die Zulassung muttersprachlicher Gottesdienste und Schulen gefordert. Ferner war ein Plakat mit der Aufschrift „Helmut, du bist auch unser Kanzler” zu sehen. Dies sah tatsächlich nach einer großen politischen Manifestation der in Polen lebenden Deutschen aus, noch dazu in Gebieten, die bis 1945 zu Deutschland gehört hatten. Es war also kaum verwunderlich, dass der demonstrative Auftritt der deutschen Minderheit in Kreisau erhebliche Besorgnisse auf polnischer Seite weckte und sich leicht für politische Zwecke missbrauchen ließ. Dennoch gelang es Bischof Alfons Nossol, diesen konfliktträchtigen Kontext geschickt zu übergehen und den Hauptakzent der Messe auf ihren Opfer- und Sühnecharakter zu legen. Bischof Nossol erinnerte sich an diese Zusammenhänge wie folgt:
Eine Stunde vor der Heiligen Messe traten an mich irgendwelche Funktionäre heran, ich denke, ehemalige Mitarbeiter des polnischen Staatssicherheitsdienstes von den damals noch General Kiszczak unter-stehenden Geheimdiensten, […] und fragten mich, ob bei der Heiligen Messe unbedingt ein Friedensgruß ausgetauscht werden müsse. „Vielleicht könnte man ihn auslassen?“ – legten sie [mir] ohne Umschweife nahe.
Der Bischof von Oppeln lehnte dies klar ab. Er verbürgte sich auch dafür, dass es seitens der Katholiken und der ebenfalls eingeladenen Protestanten zu keinen Provokationen während der Messe kommen werde. Vor Beginn des Gottesdienstes bat er daher die Teilnehmer, alle Transparente einzurollen. In seiner Predigt ging Nossol dann auf die Versöhnung des Menschen mit Gott ein, um anschließend die Versöhnung der Menschen untereinander zu reflektieren. Die Heilige Messe in Kreisau wurde so zu einer „Stunde der Gnade“, in der der göttliche Vergebungsakt seine Wirkung entfalten sollte – an den teilnehmenden Menschen selbst und gemeinsam mit anderen Menschen. Die eigentliche Schlüsselszene des Gottesdienstes, die rasch zur Ikone des deutsch-polnischen Versöhnungsprozesses wurde, bildete das sinnfällige Friedenszeichen der beiden Regierungschefs, die in einem besonderen Augenblick der Geschichte Europas zusammenkamen. Fernsehkameras aus aller Welt hatten sich auf Mazowiecki und Kohl gerichtet. Beide Staatsmänner tauschten zunächst den Friedensgruß mit Bischof Nossol aus. Kohl gab Mazowiecki daraufhin mit einer diskreten Geste zu verstehen, gemeinsam ein paar Schritte nach vorne zu machen, um für die Kameras besser sichtbar zu sein. Dann reichten sie sich die Hände, umarmten sich und drückten dabei ihre Wangen aneinander. Schließlich schüttelten sie sich nochmals die Hände und kehrten auf ihre Plätze zurück. Die auf dem Gutsgelände versammelten Gläubigen spendeten daraufhin spontanen Applaus.
Die um die Welt gehenden Bilder der Friedensgeste von Tadeusz Mazowiecki und Helmut Kohl symbolisierten den Beginn einer neuen Ära in den deutsch-polnischen Beziehungen. Sie wurden zu einer Art Pointe zum 1965 verfassten, mutigen Brief der polnischen Bischöfe an ihre deutschen Amtsbrüder, in dem überaus bedeutsame, zukunftsweisende Worte gefallen waren: „Wir vergeben und bitten um Vergebung”. Die tiefe Bedeutung der Kreisauer Messe und der dabei vollzogenen Friedensgeste wurde in den Folgejahren immer offensichtlicher. Heute kann man sich ein vereintes Europa ohne diese „Versöhnungsmesse“, die einen bislang unerreichten Höhepunkt im langwierigen Prozess der Aussöhnung von Deutschen und Polen bildet, kaum noch vorstellen.
Dieser Artikel wurde veröffentlicht in VERSÖHNUNGSMESSE IN KREISAU", Wrocław 2019









.jpg)



.png)
.png)








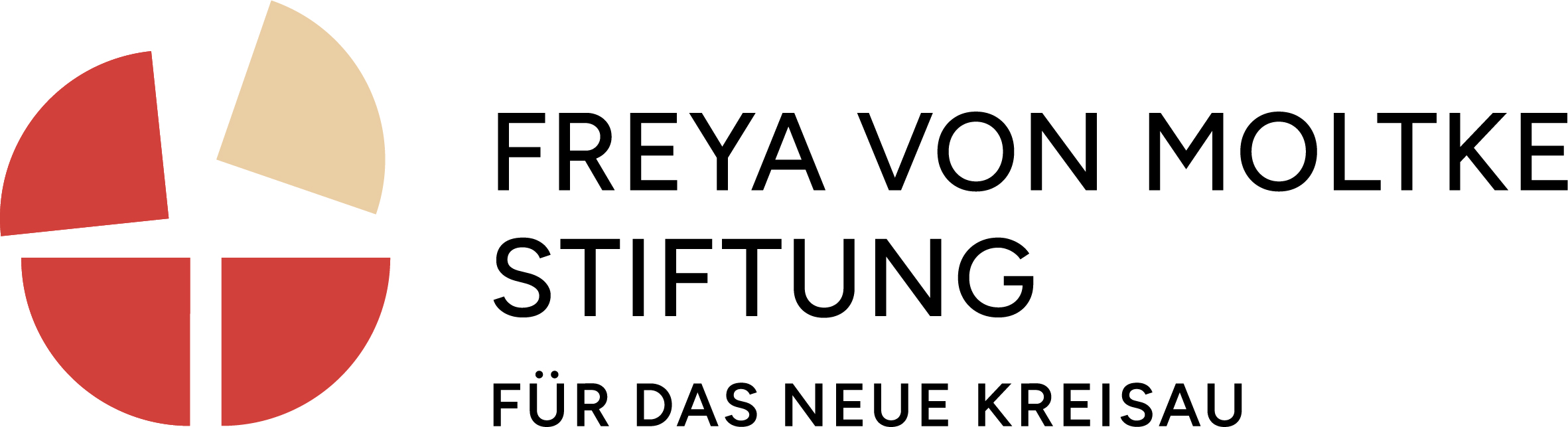
.jpg)